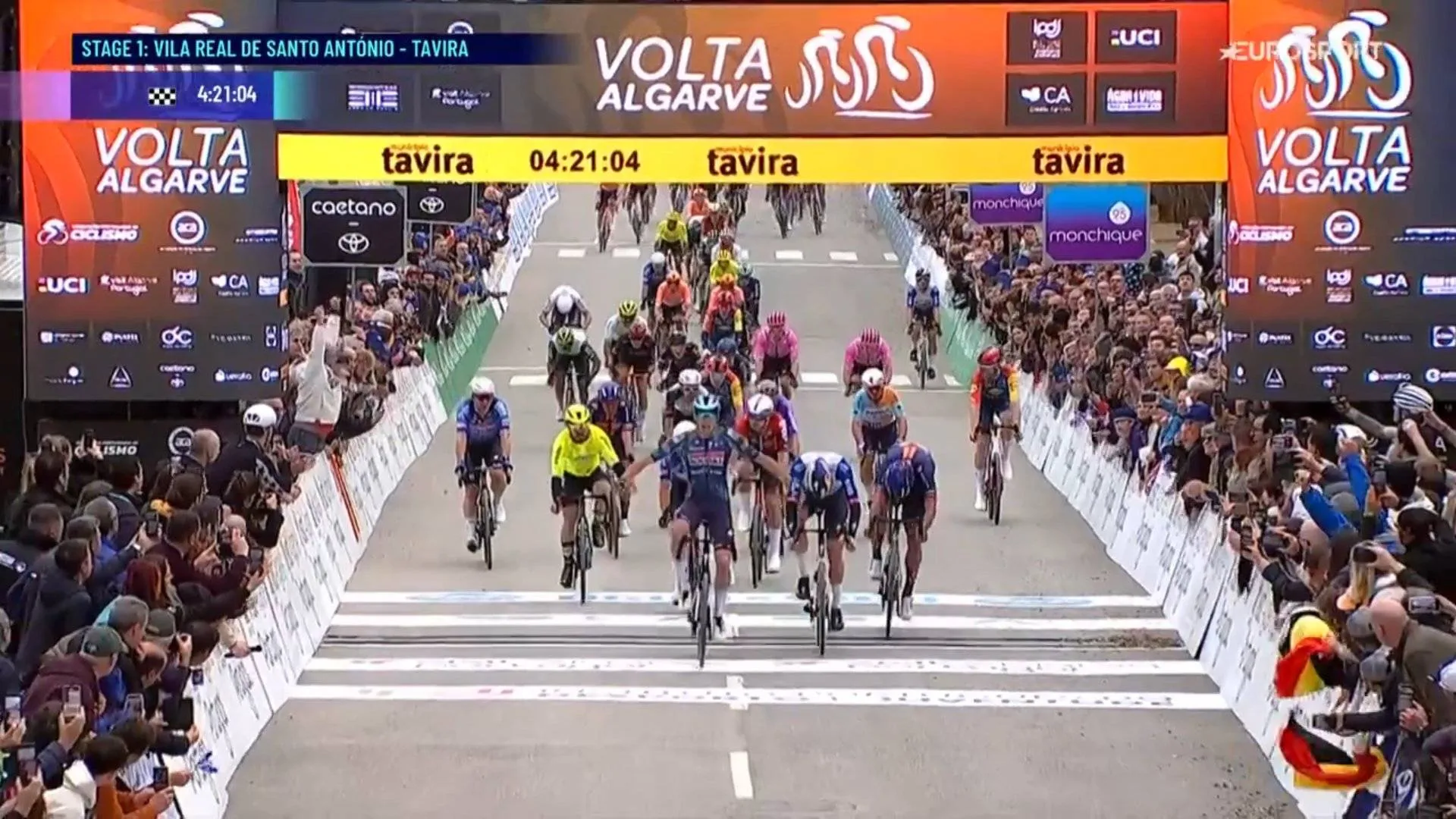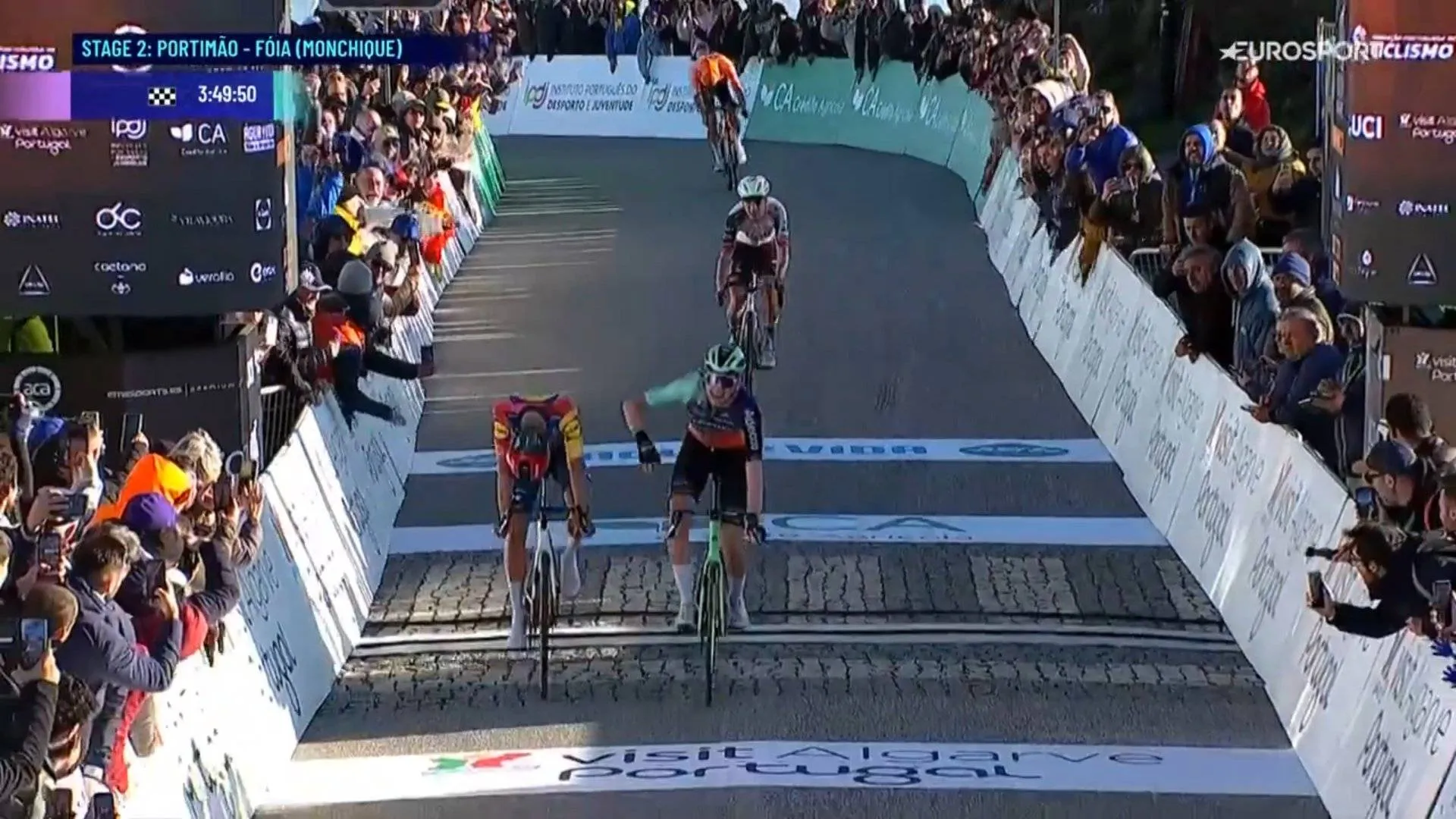Warum jede junge Radsport-Fan die tragische Geschichte von Luis Ocaña kennen sollte
RadsportDonnerstag, 29 Mai 2025 um 11:32

Die letzte Ehre für einen gefallenen Helden
Am 24. Mai 1994 wurde die Kapelle Notre-Dame des Cyclistes in Labastide d’Armagnac zum Ort der Trauer für die Radsportwelt. Nur fünf Tage zuvor, am 19. Mai, hatte sich Luis Ocaña im Alter von 48 Jahren das Leben genommen. Er litt unter schwerer Depression, finanzieller Not, Hepatitis B und Krebs – und sah keinen Ausweg mehr. In der Kapelle wurden ihm zu Ehren ein Buntglasfenster und eine grüne Marmorplatte angebracht – ein stilles Gedenken an einen der kompliziertesten Helden des Radsports.
Vom Elend bis an die Spitze des Pelotons
Luis Ocaña kannte das harte Leben. Geboren am 9. Juni 1945 im armen spanischen Dorf Priego, wuchs er mit vier Geschwistern in großer Armut auf. Häufig fehlte es an Essen. Mit zwölf Jahren floh die Familie nach Frankreich, um der Verfolgung durch Francos Regime zu entkommen – sein Vater war Republikaner. Luis war gesundheitlich angeschlagen, litt unter Tuberkulose und schwachen Lungen. Schon früh musste er auf den Feldern mitarbeiten. Doch auf dem Rad, auf dem Weg zur Schule, fand er ein Gefühl von Freiheit. Sein Vater hielt ihn für zu schwach für den Sport und war dagegen, doch Luis trat dem Radsportverein von Mont-de-Marsan bei – und bewies schnell, dass er ein geborener Sieger war.
Obwohl er seine Jugend in Frankreich verbrachte, fühlte sich Ocaña stets als Spanier. Als Profi unterschrieb er beim spanischen Team Fagor. 1969 wurde er Zweiter bei der Vuelta a España, nur knapp hinter dem Franzosen Roger Pingeon, mit Rini Wagtmans auf Rang drei. Ein Jahr später, nun Kapitän des französischen BIC-Teams, kehrte er zurück und gewann die Vuelta – obwohl ihm die Streckenführung ohne lange Zeitfahren nicht lag. Ocaña galt als stur und einzelgängerisch, doch im entscheidenden Zeitfahren dominierte er – und sicherte sich seinen ersten Grand-Tour-Sieg.
Kämpfe, Ruhm und ein einsames Ende
Die Tour de France 1971 wurde zu seinem dramatischen Duell mit Eddy Merckx. In der elften Etappe nach Orcières-Merlette setzte Ocaña zu einem 60 Kilometer langen Soloangriff an – und nahm Merckx über acht Minuten ab. Das Gelbe Trikot war zum Greifen nah. Doch in der 14. Etappe auf der Abfahrt vom Col de Menté kam es zur Katastrophe: Ein Gewitter hatte die Straße in eine Rutschbahn verwandelt, Ocaña stürzte schwer und musste das Rennen aufgeben. Sein Traum war geplatzt.
1973 folgte die Erlösung. Ocaña dominierte die Tour de France von den Alpen bis Paris, holte früh das Gelbe Trikot und verteidigte es souverän. Bernard Thévenet wurde mit fast 16 Minuten Rückstand Zweiter. Doch Merckx war nicht dabei – sehr zum Bedauern von Ocaña, der überzeugt war, ihn schlagen zu können. Aus Ironie (und vielleicht auch Frust) nannte er seinen Hund „Merckx“ – zu Hause war er damit immerhin der Herr über „Merckx“.
Nach seinem Toursieg verblasste seine Karriere allmählich. Er gewann keine große Rundfahrt mehr und beendete seine Tour-de-France-Zeit beim niederländischen Team Frisol als 25. Er widmete sich nun seinem Weingut – trank allerdings selbst zu gerne. Vom Radsport konnte er sich dennoch nie ganz lösen und arbeitete als Kommentator für französisches Fernsehen und spanisches Radio. 1979 kam es während eines Ruhetags bei der Tour zu einem kuriosen Unfall: Beim Aussteigen aus einem Auto stürzte er in eine Schlucht, brach sich Arm und Kiefer, verlor auf einem Ohr das Gehör und hatte seither Sehprobleme.
Der letzte Abstieg kam schnell. Ein Unwetter zerstörte 1983 seine Weinernte. Er versuchte sich als Berater des kolumbianischen Tour-Teams, doch die Rolle passte nie zu ihm. Später im Jahr kollidierte er mit einem LKW und verletzte sich schwer am Bein. Im Krankenhaus infizierte er sich mit Hepatitis B, woraus Leberkrebs wurde. Als er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, traf er eine endgültige Entscheidung. Seine Familie konnte es nicht glauben und verdächtigte zunächst seine Frau Josiane, befeuert durch Gerüchte über eine Affäre – doch diese erwiesen sich als haltlos. Die Wahrheit war tragischer: Luis Ocaña hatte einfach keine Kraft mehr zu kämpfen.
Weiterlesen
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Wann war Vingegaard denn Weltmeister? Außerdem legt der Artikel nahe, dass er die letzte Tour de France gewonnen hat, was nicht der Fall war - "lange erwartet.., historischer Sieg.." den letzten Erfolg erzielte Jonas mit dem Gesamtsieg der Vuelta 2025 . Sicherlich war die EM von den Dänen anders geplant, aber sie haben das Beste daraus gemacht.ando06-10-2025
- Für Lidl Trek wäre es eine gute GC Option. Ich hoffe nur für Lidl das er teamfähig sein kann, oder ihn Lidl dahingehend umerziehen kann. Radsport ist Teamsport, und da hat Ayuso bisher leider nicht überzeugt.Franke8630-08-2025
Loading