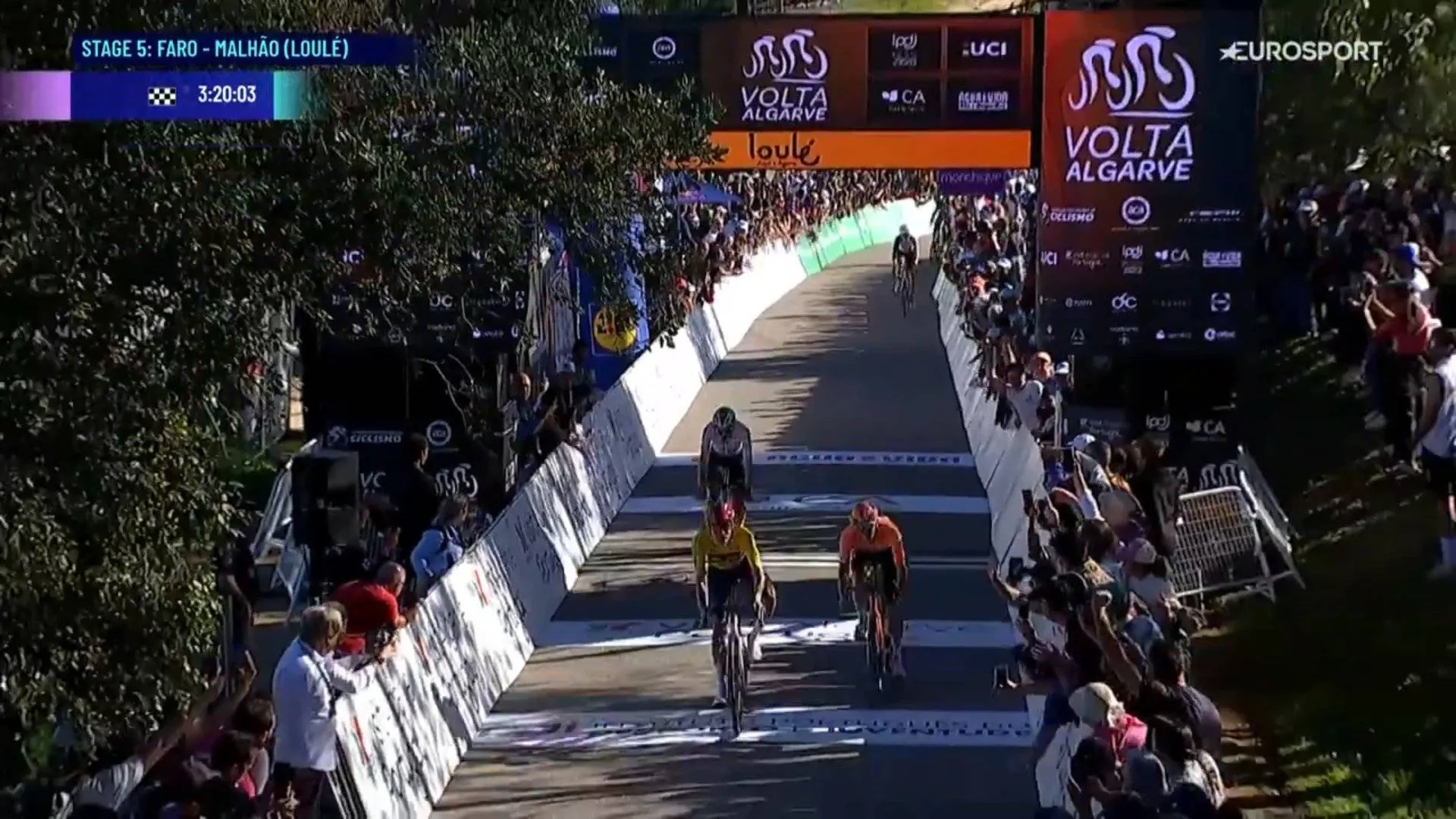„Es hat mich nicht glücklich gemacht, nur mitzurollen“ – Wout van Aert räumt ein, mental mit den anhaltenden Folgen seiner Stürze 2024 gekämpft zu haben
RadsportMittwoch, 03 Dezember 2025 um 19:00

Wout van Aert geht in den Winter mit einem klareren Bild davon, wer er als Fahrer ist — doch der Weg dorthin dauerte länger und schnitt tiefer, als viele ahnten.
Im offenen Gespräch mit Het Nieuwsblad nach einem der härtesten Jahre seiner Karriere blickte der 31-Jährige auf die mentalen Nachwirkungen seiner brutalen Saison 2024 und darauf, wie ein ruhiger, risikoarmer Ansatz zu Beginn dieses Jahres ihm fast die einst selbstverständliche Freude genommen hätte.
Er mag 2025 mit zwei unvergesslichen Siegen beendet haben — diesem explosiven Triumph auf dem Schotter nach Siena und natürlich dem Abhängen von Tadej Pogacar am Montmartre — doch der Weg dorthin war unordentlich, fragil und voller Momente, in denen sich der Sport eher auslaugend als erfüllend anfühlte.
Ein Frühjahr im Zurückhalten
Van Aert scheute die unbequeme Wahrheit nicht: Die Narben von 2024 folgten ihm weit hartnäckiger in das Jahr 2025, als er erwartet hatte.
Phasenweise im Frühjahr, sagte er, steckte er zwischen Erleichterung über vermiedene Risiken und Frust über fehlende Entschlossenheit. „Dann traute ich mich nicht, mich reinzuwerfen, und pendelte zwischen der Freude, nicht gestürzt zu sein, und der Frustration, nicht in Position zu sein.“
Er erkannte schnell, dass der übervorsichtige Stil, in den er hineingerutscht war, nicht seinem Wesen entspricht. „Ich habe gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht, einfach nur mitzufahren.“
Es ging dabei nicht nur um Form oder Fitness. Er räumte offen ein, dass Positionsprobleme — besonders sichtbar bei einigen der großen Klassiker — durch Zögern verstärkt wurden, nicht nur durch die Beine.
Wo frühere Versionen von Van Aert instinktiv in Lücken stachen, bremste er sich dieses Jahr häufig. Sich mit diesem Wandel zu arrangieren, war kompliziert, aber nötig. „Vielleicht habe ich es zu sehr aufgebauscht, denn ich war in Position, wenn ich nicht darüber nachgedacht habe,“ sagte er.
Weiterlesen
Nach der Tour kam die Klarheit
Der echte Reset kam erst, als die Tour de France vorbei war. Van Aert wählte einen ruhigeren Herbst, fand ihn jedoch unbefriedigend — eine Erinnerung an seine wettkampfgetriebene DNA. „Ich bin ein paar Rennen ohne Leistungsdruck gefahren und habe dadurch nicht mein bestes Niveau erreicht und war einfach nur dabei. Rückblickend wäre es besser gewesen, die auszulassen, denn es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht,“ gab er zu.
Diese Phase schärfte, was für ihn essenziell ist: Er muss am Limit fahren, nicht nur teilnehmen. „Ich weiß jetzt sehr klar, dass Rennen für mich bedeutet, mein absolutes Höchstniveau zu erreichen und alles zu geben.“
Dwars door Vlaanderen: ein Moment, der tiefer schnitt als erwartet
Einer der öffentlichsten Zündpunkte des Jahres war Dwars door Vlaanderen, wo Visma einen Drei-gegen-eins-Vorteil gegen den US-Amerikaner Neilson Powless verspielte. Der Fokus lag schnell auf Van Aert, der sich entschied, selbst zu sprinten statt einen Teamkollegen zu lancieren — eine Entscheidung, die er sofort bereute.
„Ich war extrem enttäuscht von mir, weil ich in dem Moment, als ich mich für den Sprint entschied, nicht meiner Linie treu blieb,“ sagte er. Er wollte den Sieg zu sehr und fürchtete, ein Teamkollege könnte ihm die Chance nehmen.
Entscheidend war, dass seine Teamkollegen und DS Grischa Niermann nicht nachtraten. Die Unterstützung erdete ihn, statt ihn zu erdrücken. „Es hat mir enorm geholfen, dass ich von niemandem Frust oder Ärger mir gegenüber gespürt habe,“ sagte Van Aert.
Der Hunger zu gewinnen war weiterhin da — Instinkt und Antrieb — doch er wusste, die Entscheidung war falsch. Nicht peinlich, nicht katastrophal, einfach falsch.
Druck, Erwartungen und das Bedürfnis, etwas zu beweisen
Zum Saisonstart erwartete die Außenwelt, dass Van Aert sofort sein altes Niveau wiederfindet. Diese Erwartung, räumte er ein, hielt sich stärker, als ihm bewusst war.
Demi Vollering sprang ihm öffentlich in den sozialen Medien bei und betonte, dass Topathleten unter Druck bisweilen unvollkommene Entscheidungen treffen — besonders wenn Außenstehende nicht wissen, welche inneren Stürme sie bewältigen. Van Aert widersprach nicht. „Man will vielleicht nicht in erster Linie für sich selbst gewinnen, sondern eher sagen: Schaut, ich kann immer noch gewinnen,“ sagte er. Nicht für Schlagzeilen, nicht gegen Kritiker — sondern zur Selbstvergewisserung. Und dieses Bedürfnis nach einer Antwort wuchs, als die Leistungen am Opening Weekend und bei der E3 Saxo Classic ausblieben. „Ohne es zu merken, willst du darauf vielleicht eine Antwort geben,“ reflektierte er.
Wiederentdecken, warum er Rennen fährt
Am Ende zog sich durch alles Gesagte — von den Frühlingszweifeln bis zur Herbstfrustration — die Suche nach Freude. Nicht Bequemlichkeit. Nicht Sicherheit. Echte Erfüllung.
Dieses Gefühl kehrte in Siena zurück, unter Staub und Chaos des Giro, als er gewann, obwohl er nicht glaubte, dass ihm der Tag liegen würde. „Es gibt nicht viele Siege, an die das Gefühl heranreicht. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber spreche,“ sagte er. „Es war eine schwierige Phase, die sich schließlich ins Positive gewendet hat. Es hat alles zusammengepasst.“ Es war ein Wendepunkt, der aus echter Belastung entstand. Früher in diesem Giro gestand er: „Am fünften Tag habe ich mich gefragt, ob es überhaupt Sinn macht zu bleiben.“ Doch der Sieg drehte die emotionale Erzählung.
Weiterlesen
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Wann war Vingegaard denn Weltmeister? Außerdem legt der Artikel nahe, dass er die letzte Tour de France gewonnen hat, was nicht der Fall war - "lange erwartet.., historischer Sieg.." den letzten Erfolg erzielte Jonas mit dem Gesamtsieg der Vuelta 2025 . Sicherlich war die EM von den Dänen anders geplant, aber sie haben das Beste daraus gemacht.ando06-10-2025
- Für Lidl Trek wäre es eine gute GC Option. Ich hoffe nur für Lidl das er teamfähig sein kann, oder ihn Lidl dahingehend umerziehen kann. Radsport ist Teamsport, und da hat Ayuso bisher leider nicht überzeugt.Franke8630-08-2025
Loading