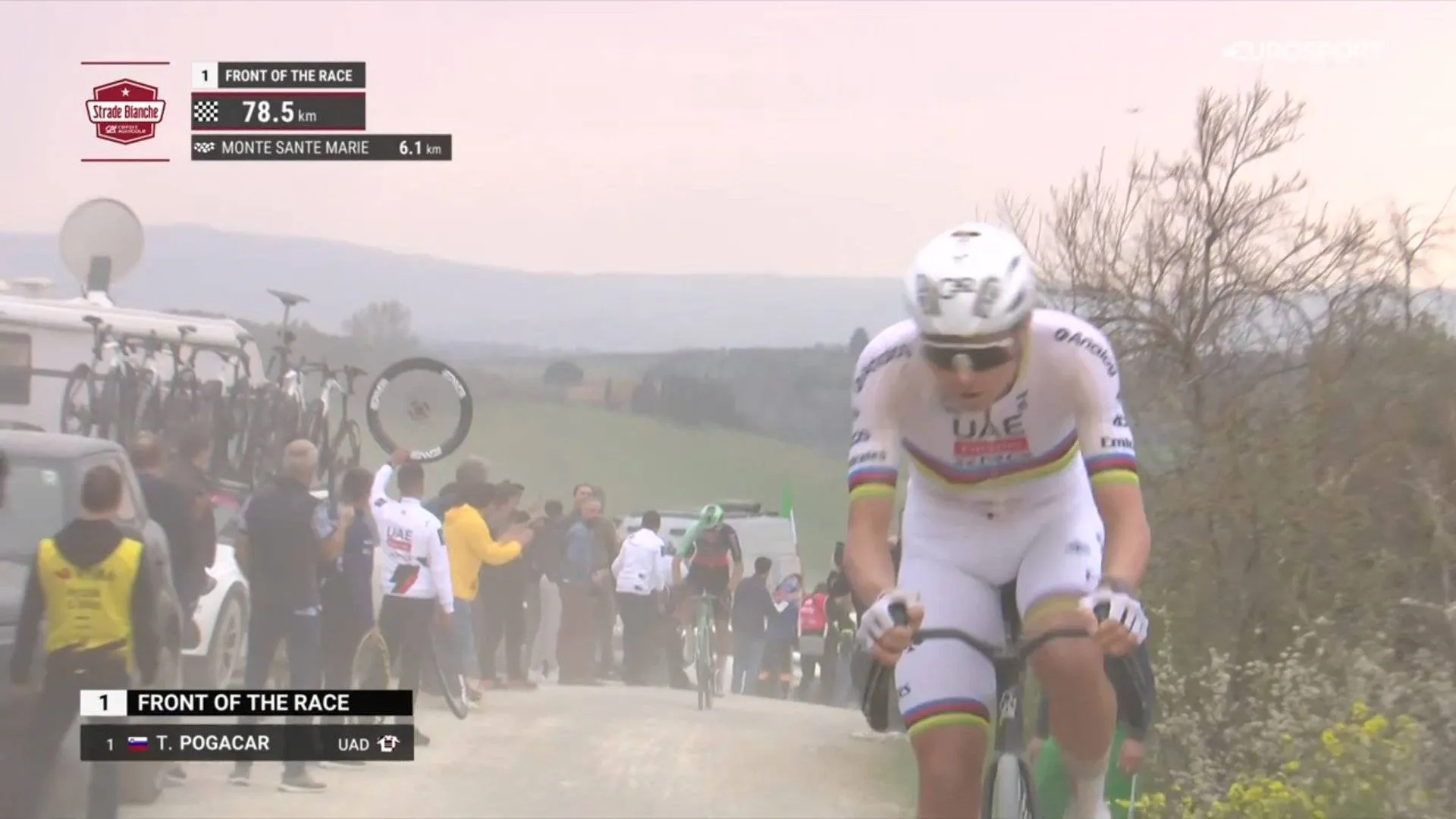„Die Rennen, die ich als Sprinter gewinnen kann, habe ich gewonnen“ – Tim Merlier deutet eine Verschiebung seiner Ziele an, mit Milano–Sanremo, Gent-Wevelgem und Paris–Roubaix im Visier
RadsportFreitag, 02 Januar 2026 um 12:30

Über weite Strecken des vergangenen Jahrzehnts wurde Tim Merlier vor allem durch eines definiert: Geschwindigkeit. Unerbittliche, reproduzierbare, weltklasse Geschwindigkeit, die ihm in einer Saison 16 Siege einbrachte und seinen Status als einer der gefürchtetsten Finisher im Peloton festigte.
Hinter diesem Erfolg vollzieht sich jedoch leise eine Neubewertung. Keine Unzufriedenheit, sondern Perspektive. Merlier jagt nicht mehr dem Beweis nach, welcher Sprinter er ist. Stattdessen fragt er, was darüber hinaus noch möglich sein könnte. „Die Rennen, die ich als Sprinter gewinnen kann, habe ich gewonnen“, sagte er im Gespräch mit Sporza. Das ist keine Resignation, sondern eine Neukalibrierung.
Wenn Platz zwei mehr sagt als sechzehn Siege
Würde man Merliers Saison nur an Zahlen messen, wäre die Geschichte schnell erzählt. Sechzehn Siege sprechen für sich. Doch das Ergebnis, das ihm am deutlichsten im Kopf bleibt, ist keines dieser Rennen, sondern der zweite Platz bei Gent-Wevelgem, das jetzt offiziell In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem heißt.
Der Kontext zählt. Er kam mit den Nachwirkungen eines schweren Sturzes bei Brugge-De Panne an, genäht und unsicher, ob ein Start überhaupt realistisch war. Er fuhr nicht aus Instinkt oder Dominanz, sondern aus Zähigkeit. „Ich war eigentlich nicht im Rennen, aber ich habe mich festgebissen und den Sprint um Platz zwei gewonnen. Diese Position fühlte sich wie ein Sieg an.“
Das ist eine aufschlussreiche Einordnung. Für einen Fahrer, der Erfolg gewohnt ist in Form sauberer Abschlüsse und erhobener Arme, bedeutete dieser Moment etwas anderes. Ausdauer. Glaube. Und das Gefühl, dass manche Rennen eine Belohnung jenseits des Ergebnisblatts bieten. „Gent-Wevelgem ist ein unterschätztes Rennen“, sagte Merlier. „Viele denken, es sei ein Sprintrennen, aber es öffnet sich früh und kommt nie wirklich zur Ruhe.“
Weiterlesen
Warum ihn die Klassiker weiter anziehen
Merlier ist realistisch, was es bräuchte, um Gent-Wevelgem tatsächlich zu gewinnen. Er verklärt es weder zur Unvermeidbarkeit noch zur Bestimmung. „Ich brauche einen Sprint aus einer kleinen Gruppe und Wunderbeine. Und dann muss ich immer noch richtig positioniert sein.“
Diese Nüchternheit prägt auch seinen Blick auf die Frühlingsmonumente insgesamt. Milano-Sanremo etwa ist für ihn in der heutigen Zeit jenseits der praktischen Grenzen eines reinen Sprinters. Er hat kein Interesse daran, mit extremen Trainingsanpassungen seine größte Waffe zu stumpfen. „Ich glaube weiterhin an das Prinzip, ein reiner Sprinter bleiben zu wollen“, sagte er. „Mit dem aktuellen Peloton ist Milano-Sanremo unmöglich.“
Paris-Roubaix ist anders. Brutal, unberechenbar, geprägt von Positionierung und Überleben ebenso wie von reiner Kraft. Ein Rennen, das für ihn noch nie wirklich zusammenlief, das aber in seinem Kopf präsent bleibt. „In Paris-Roubaix hat es noch nie gepasst, um auf Ergebnis zu fahren, aber in meinem Kopf ist es Zeit, das zu ändern.“
Nicht um zu gewinnen, betont er. Um mitzufahren. Um etwas Greifbares aus einem Rennen mitzunehmen, das sich zunehmend unvollendet anfühlt.
Später Erfolg und die Freiheit, die er bringt
Merliers Karrierebogen ist entscheidend. Er kam spät auf die Straße, baute seinen Ruf geduldig auf und stapelte erst dann Siege auf höchstem Niveau, als das Fundament stand. Diese Spätblüte prägt seinen Blick auf die spätere Karrierephase. „Große Sprünge mache ich nicht mehr, aber Babyschritte sind noch drin“, sagte er. „Ich hoffe, ich kann als Sprinter noch besser werden. Daran arbeite ich jedes Jahr.“
Diese Babyschritte sind keine Neuerfindung. Es geht um Langlebigkeit. Darum, seinen Sprint scharf zu halten und gleichzeitig Raum für gelegentliche Abstecher in der Ambition zu lassen, sei es Gent-Wevelgem oder ein tieferer Lauf in Paris-Roubaix.
Es geht auch um Wertschätzung. Die erneute Nominierung für den Vélo d’Or, auch ohne Teilnahme an der Gala, zwang zu einem Moment des Innehaltens. „Man merkt schon, dass man in seiner Karriere etwas erreicht hat“, sagte Merlier. „Manchmal muss man stehen bleiben und reflektieren, was man getan hat. Aber man merkt auch, dass es von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Also sollte man es mehr genießen.“
Nach vorn blicken, ohne das Ende zu erzwingen
Vertraglich bis 2028 gebunden, erlaubt sich Merlier bereits einen etwas weiteren Blick. „Ich würde gerne bis 2030 Profi bleiben“, sagte er. „Das wäre ein schönes Alter, um aufzuhören.“
In seinen Worten liegt keine Hast. Keine letzte Chance. Eher Ruhe. Er fühlt sich weiterhin konkurrenzfähig. Er ist weiterhin neugierig. Und vor allem glaubt er, dass sein Sprint nicht nachgelassen hat.
Ob diese Zukunft einen perfekten Frühjahrsklassiker, ein lang erwartetes Ergebnis in Paris-Roubaix oder einfach weitere Tage dessen umfasst, was er besser kann als fast jeder andere, Merlier wirkt im gefundenen Gleichgewicht zufrieden.
Er hat bewiesen, wer er als Sprinter ist. Jetzt erkundet er leise, was darüber hinaus noch passt.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Wann war Vingegaard denn Weltmeister? Außerdem legt der Artikel nahe, dass er die letzte Tour de France gewonnen hat, was nicht der Fall war - "lange erwartet.., historischer Sieg.." den letzten Erfolg erzielte Jonas mit dem Gesamtsieg der Vuelta 2025 . Sicherlich war die EM von den Dänen anders geplant, aber sie haben das Beste daraus gemacht.ando06-10-2025
- Für Lidl Trek wäre es eine gute GC Option. Ich hoffe nur für Lidl das er teamfähig sein kann, oder ihn Lidl dahingehend umerziehen kann. Radsport ist Teamsport, und da hat Ayuso bisher leider nicht überzeugt.Franke8630-08-2025
Loading