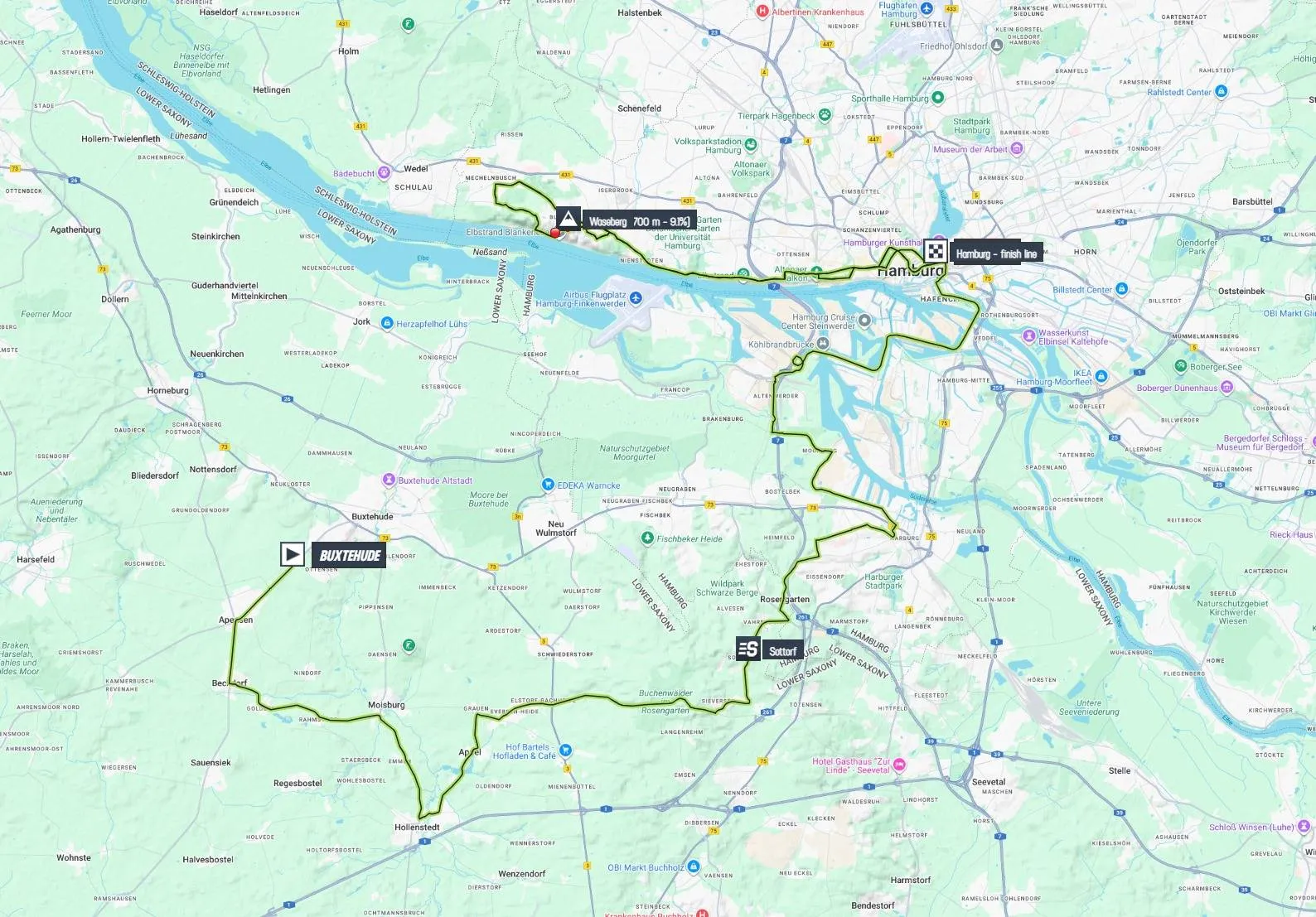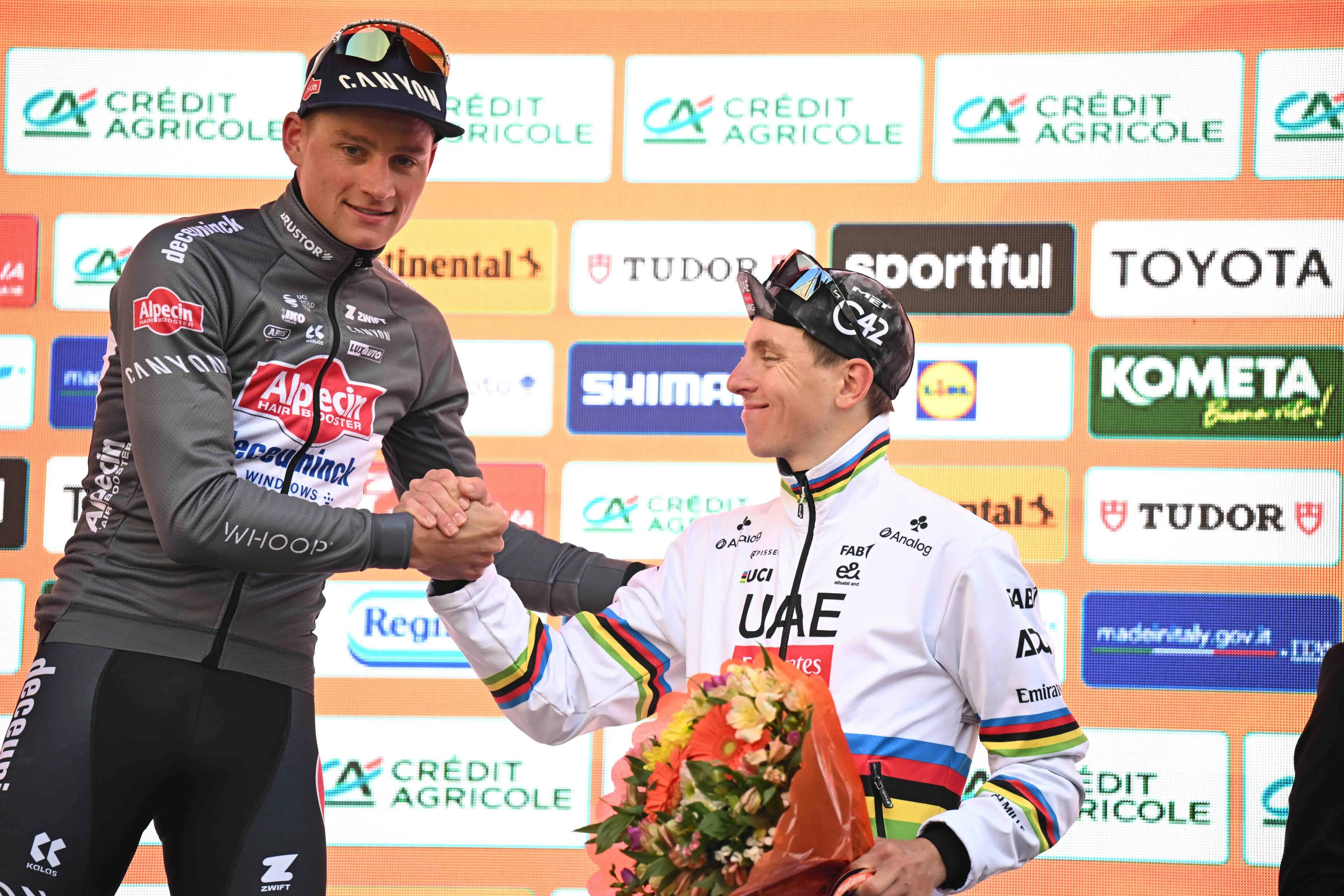MEINUNG | Wer schützt die Fahrerinnen? Die Tour de Romandie Féminin zeigt eine gefährliche Lücke im Radsport
RadsportSonntag, 17 August 2025 um 13:38

Die Tour de Romandie Feminin 2025 sollte eigentlich ein Symbol für den Aufstieg des Frauenradsports werden. Ein wachsendes Publikum, ein zunehmend professionelles Peloton, immer größere Medienaufmerksamkeit – all das versprach eine Ausgabe, die die Stellung des Rennens im internationalen Kalender festigen würde. Stattdessen wurde das Rennen schon vor dem eigentlichen Start von einem Eklat überschattet, der noch lange nachhallen dürfte.
Am ersten Tag wurden sechs der größten und erfolgreichsten WorldTour-Mannschaften disqualifiziert. Teams wie Visma | Lease a Bike, Canyon//SRAM, EF-Oatly-Cannondale, Lidl-Trek oder AG Insurance-Soudal waren nicht mehr am Start, nachdem sie sich weigerten, den von der UCI vorgeschriebenen Einsatz eines neuen GPS-Trackingsystems unter den gegebenen Bedingungen zu akzeptieren. Damit war das Rennen faktisch entwertet, und der Skandal stand im Mittelpunkt der Berichterstattung – nicht der Sport selbst.
Ein Streit ohne Sieger
Das Erschütternde an dieser Entwicklung ist nicht nur die Disqualifikation an sich, sondern das völlige Fehlen von Verantwortungsbewusstsein. Keine der beteiligten Parteien – weder die Teams, noch die Veranstalter, noch der Dachverband UCI – ist bereit, die Schuld auf sich zu nehmen.
Die Organisatoren erklärten, es sei „bedauerlich und unglücklich, dass keine positive Lösung gefunden werden konnte“. Hinter dieser Formulierung verbirgt sich ein offenkundiges Scheitern: das Scheitern an Kommunikation, das Scheitern an Kompromissbereitschaft, das Scheitern daran, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Die UCI wiederum kritisierte die Teams in ungewöhnlich scharfen Worten. Deren Entscheidung, sich den Regeln zu widersetzen, „untergrabe die Bemühungen, die Sicherheit der Fahrerinnen zu erhöhen“. Doch genau diese Sicherheit war es, die im Streit auf der Strecke blieb. Denn am Ende blieben nur die Fahrerinnen und die Fans auf der Strecke, die sich ein sportliches Highlight erhofft hatten – und stattdessen einen Machtkampf vorgesetzt bekamen.
Warum dieses System so wichtig wäre
Um die Bedeutung dieses Konflikts zu verstehen, muss man sich den Anlass vor Augen führen. Das GPS-System war nicht irgendeine technische Neuerung. Es wurde als Antwort auf eine Tragödie eingeführt, die den Radsport im vergangenen Jahr erschütterte: den Tod der 18-jährigen Schweizerin Muriel Furrer bei den Juniorinnen-Weltmeisterschaften in Zürich.
Furrer kam bei einer Abfahrt von der Straße ab und stürzte in ein Waldstück. Erst nach einer längeren Suche wurde sie gefunden, schwer verletzt. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, überlebte aber nicht. Was diese Tragödie noch bitterer machte, war die Unsicherheit: Eine Zeit lang wusste niemand, wo genau die Fahrerin war.
Das neue GPS-System sollte sicherstellen, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Bei Stürzen in unübersichtlichem Gelände sollten die Athletinnen sofort lokalisiert werden können, sodass medizinische Hilfe schneller eingreifen kann. Es war ein Projekt, das von vielen als überfällig angesehen wurde – und von der UCI als „Meilenstein für die Sicherheit im Straßenradsport“ gefeiert wurde.
Blockade statt Zusammenarbeit
Doch die Umsetzung offenbarte die Bruchlinien im Radsport. Die Teams kritisierten, dass sie die Geräte selbst installieren müssten, ohne ausreichende technische Unterstützung, und im Schadensfall für Verluste oder Defekte haftbar gemacht würden. Für viele Teams war das nicht akzeptabel – nicht aus Trotz, sondern aus der Überzeugung, dass Sicherheit nicht allein auf ihre Schultern geladen werden darf.
Die UCI wiederum pochte auf den Test im Rahmen der Romandie. Für sie war dieses Rennen ein Pilotprojekt, ein Schaufenster, das zeigen sollte, dass das System funktioniert und bald weltweit eingeführt werden kann. Stattdessen wurde es zum Paradebeispiel dafür, wie mangelnde Abstimmung zwischen Verbänden, Organisatoren und Teams eine an sich sinnvolle Idee zum Scheitern bringen kann.
Die Leidtragenden waren am Ende nicht die Funktionäre, sondern die Fahrerinnen. Ein WorldTour-Rennen, auf das sich viele vorbereitet hatten, verlor auf einen Schlag seine sportliche Bedeutung. Und der Sport selbst verlor erneut an Glaubwürdigkeit.
Weiterlesen
Ein Jahr nach Muriel Furrers Tod – nichts gelernt
Besonders bitter ist der Zeitpunkt. Fast genau ein Jahr nach dem tragischen Tod von Muriel Furrer zeigt dieser Konflikt, dass der Radsport wenig dazugelernt hat. Man hätte erwarten können, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, um die Lehren aus diesem Unglück in konkrete Verbesserungen umzusetzen. Stattdessen ist man weiter von einer Einigung entfernt denn je.
Furrer war keine anonyme Nachwuchsfahrerin. Sie war eine zweifache Medaillengewinnerin bei den Schweizer Meisterschaften, eine ehrgeizige und talentierte Sportlerin mit klarer Perspektive. Sie wurde als „warmherzige und wunderbare junge Frau, die immer ein Lächeln im Gesicht hatte“ beschrieben. Die UCI selbst nannte sie „eine Fahrerin mit glänzender Zukunft“. Umso schlimmer, dass ausgerechnet die Einführung einer Technologie, die ihr hätte helfen können, nun an Kompetenzgerangel und mangelnder Verantwortung zu scheitern droht.
Verantwortung statt Schuldzuweisung
Natürlich ist es einfach, Schuld zuzuweisen. Die UCI war starr und unflexibel. Die Organisatoren waren nicht in der Lage, eine Lösung zu finden, die ihre Star-Teams im Rennen gehalten hätte. Und die Teams selbst verhielten sich kompromisslos. Doch der Kern des Problems liegt tiefer: Alle Beteiligten haben ihre gemeinsame Verantwortung aus den Augen verloren.
Der Radsport versteht sich gern als „Familie“. Aber was ist eine Familie wert, die interne Machtkämpfe über die Sicherheit ihrer Mitglieder stellt? Eine Familie, die die Erinnerung an ein verstorbenes Kind nicht als Ansporn begreift, sondern zulässt, dass ein Pilotprojekt zur Farce verkommt?
Was jetzt passieren muss
Der Skandal von Romandie darf nicht folgenlos bleiben. Wenn der Radsport das Andenken an Muriel Furrer ernsthaft ehren will, darf es nicht bei Beileidsbekundungen und Schweigeminuten bleiben. Die UCI muss Wege finden, ihre Projekte so umzusetzen, dass sie die Teams einbezieht, statt sie zu übergehen. Die Organisatoren müssen flexibel genug sein, um Lösungen vor Ort zu ermöglichen. Und die Teams müssen sich ihrer Mitverantwortung stellen und konstruktiv mitarbeiten, statt sich zu verweigern.
Ja, Radsport wird nie völlig sicher sein. Aber er kann sicherer werden. Und genau das schuldet die sogenannte „Radsportfamilie“ nicht nur den Profis von heute, sondern auch den Talenten von morgen – jenen jungen Fahrerinnen, die mit Hoffnungen und Träumen ins Peloton eintreten.
Bis dahin aber bleibt die Tour de Romandie Féminin 2025 als Skandal in Erinnerung: ein Rennen, das nicht durch sportliche Leistungen Schlagzeilen machte, sondern durch das Scheitern eines Systems, das eigentlich Leben schützen sollte.
Weiterlesen
Klatscht 1Besucher 1
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Wann war Vingegaard denn Weltmeister? Außerdem legt der Artikel nahe, dass er die letzte Tour de France gewonnen hat, was nicht der Fall war - "lange erwartet.., historischer Sieg.." den letzten Erfolg erzielte Jonas mit dem Gesamtsieg der Vuelta 2025 . Sicherlich war die EM von den Dänen anders geplant, aber sie haben das Beste daraus gemacht.ando06-10-2025
- Für Lidl Trek wäre es eine gute GC Option. Ich hoffe nur für Lidl das er teamfähig sein kann, oder ihn Lidl dahingehend umerziehen kann. Radsport ist Teamsport, und da hat Ayuso bisher leider nicht überzeugt.Franke8630-08-2025
Loading